Der Name
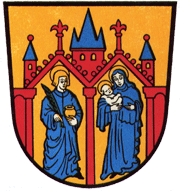 Willebadessen, mundartlich Willebosen, kommt zuerst in einer Urkunde von 1066 bei der Grenzbezeichnung eines königlichen Forstbannes Kaiser Heinrichs V. vor und wird dort Wilbotissun genannt. Der Name dieser Siedelung hat sich dem wechselnden Sprachgebrauch nach im Laufe der Jahrhunderte oft verändert. Es finden sich in Urkunden Namen wie Wilbadesen, Wilbadensen, Wilbadessen, Wilbasen, Wilbadsen, Wilbodissen, WiIboldissen, WiIlbadessen, Wilpedessen, Wylbodessen, Wildbadessen, Wildebodessen u. a. Der ursprüngliche Name ist entstanden aus dem Vorwort "Wilbot" (Willebad) und dem Nachwort "sen", einer Kurzform von "hausen". Der Name bedeutet einen Haupthof des Wilbot mit einigen zugehörigen Nebenhöfen (nach Jellinghaus, Ortsnamen). Die Siedelung ist aber bedeutend älter und bestand schon sicher in sächsischer Zeit, wie alle alten Orte mit dem "hausen"-Namen. Die erste Namensbezeichnung dürfte somit bis in die Jahre 600 v. Chr. reichen. Der Ort als Hofsiedelung ist aber viel älter und bestand bereits in vorgeschichtlicher Zeit. Ja, er war schon im Neolithikum (jüngere Steinzeit, 2500-1800 v. Chr.) mit Sicherheit bewohnt, wie die bisherigen Bodenfunde bezeugen. (Fragment einer nordischen Basaltaxt, eine Streitaxt der jütländischen Schnurkeramik aus einem Baumsarg von der Kuhweide, mehrere geschliffene Steinkeile, Spielsteinchen und Feuersteinmikrolithen, mehrere Bronzezeitgrabhügel im Langenberg, eine verschollene römische Münze vom Schulplatz.)
Willebadessen, mundartlich Willebosen, kommt zuerst in einer Urkunde von 1066 bei der Grenzbezeichnung eines königlichen Forstbannes Kaiser Heinrichs V. vor und wird dort Wilbotissun genannt. Der Name dieser Siedelung hat sich dem wechselnden Sprachgebrauch nach im Laufe der Jahrhunderte oft verändert. Es finden sich in Urkunden Namen wie Wilbadesen, Wilbadensen, Wilbadessen, Wilbasen, Wilbadsen, Wilbodissen, WiIboldissen, WiIlbadessen, Wilpedessen, Wylbodessen, Wildbadessen, Wildebodessen u. a. Der ursprüngliche Name ist entstanden aus dem Vorwort "Wilbot" (Willebad) und dem Nachwort "sen", einer Kurzform von "hausen". Der Name bedeutet einen Haupthof des Wilbot mit einigen zugehörigen Nebenhöfen (nach Jellinghaus, Ortsnamen). Die Siedelung ist aber bedeutend älter und bestand schon sicher in sächsischer Zeit, wie alle alten Orte mit dem "hausen"-Namen. Die erste Namensbezeichnung dürfte somit bis in die Jahre 600 v. Chr. reichen. Der Ort als Hofsiedelung ist aber viel älter und bestand bereits in vorgeschichtlicher Zeit. Ja, er war schon im Neolithikum (jüngere Steinzeit, 2500-1800 v. Chr.) mit Sicherheit bewohnt, wie die bisherigen Bodenfunde bezeugen. (Fragment einer nordischen Basaltaxt, eine Streitaxt der jütländischen Schnurkeramik aus einem Baumsarg von der Kuhweide, mehrere geschliffene Steinkeile, Spielsteinchen und Feuersteinmikrolithen, mehrere Bronzezeitgrabhügel im Langenberg, eine verschollene römische Münze vom Schulplatz.)
Das Fehlen von bandkeramischen Relikten ("Schuhleistenkeile" und Topfscherben) lassen vermuten, daß die frühesten Bewohner hier keinen oder nur sehr wenigen Ackerbau getrieben, dagegen sich fast nur mit Viehzucht, Jagd und Fischerei beschäftigt haben. Die teils sehr sumpfigen, schweren Keuper-, tonigen Lehm- und Juraböden sowie die dürren und mageren Kalkböden im Osten boten der damaligen Ackerbearbeitung große, kaum zu bewältigende Schwierigkeiten. Die großen Waldgebiete enthielten reiche Wild und Weidegründe sowie Kräuter, Wurzeln, Beeren, Nüsse, Pilze u. a. Die vielen kleinen und größeren Gewässer wie auch die Sümpfe und Moore gaben dem damaligen Menschen allerlei Nahrung an Grün und Getier (Wildgeflügel, Schnecken, Frösche, Krebse, Muscheln und Fische). Nur an kleinen, trockneren Stellen wird ein dürftiger Feldbau möglich gewesen sein (Einkorn, Hafer, Gerste, Hülsenfrüchte, Flachs). Rindvieh, Schweine, Ziegen, Schafe und später auch Pferde waren die Haustiere. Im Laufe der großen Rodungsperioden (500-800-1250 n. Chr.), der Waldverwüstungen (1622-48) und der Ackerausweitungen (1765-1860) wurde die jetzige Feldflur geschaffen. Vor und in der großen Wüstungszeit (1350-1450) kamen die Ackerflächen benachbarter verwüsteter Orte und Höfe, deren Bewohner verdorben oder in die mit Wall, Graben und Mauern geschützte "Stadt" Willebadessen (1318) gezogen waren, hinzu. Andere Hoffluren wurden schon früher durch Schenkung und Kauf vom Kloster zu dem alten Besitz hinzugewonnen-. Ahusen (1158), Albachtessen (1233), Etelersen (12,38), Himmelhosen (1250), Wirdessen (1262), Rickersen (1262), Hadeburghusen (Haferhausen 1149/1307), die Laake (1149), Bülheim (1203/23) und Overide (1403). Albachtessen lag zwischen der Laake und Borlinghausen, Etelersen (Edelersen) an der Nethe nach Haferhausen zu, Himmelhosen (-husen) beim jetzigen Vorwerk Stockhof, Wirdessen (Wernessen) und Guntersen (Günse) östlich der Straße nach Neuenheerse, Rickersen (Ricksen) am Hagenfeld unter dem Mühlenberge unweit der Waldmühle, Aliusen und Overilde (Overde) bei Peckelsheim, Hadeburghusen, benannt nach Hadeburg, der Gemahlin des Grafen Osdag (966), einem Vorfahren des Klosterstifters Lulthold von Osdagessen, das jetzige Haferhausen, die Laake, das heutige Borlinghauser Vorwerk und Bühlheim jenseits der Egge zwischen Kleinenberg und Lichtenau. Alle diese Gehöfte und Wohnplätze waren um 1514 verlassen ("wüst"), mit Ausnahme von Bühlheim, Haferhausen und der Laake. Die genaue Lage der wüsten Orte lassen sich an Hand der alten Flurnamen noch heute feststellen. Die Gemeindeflur zerfiel seit der Klostergründung (1149) bis zur Aufhebung (1810) in Dorf- und Klosterbesitz. Letzterer ging durch Kauf am 8. 9.1810 in gutsherrlichen Besitz (v. Spiegel zu Borlinghausen - v. Elmendorff - (1839) Ullrich v.Wrede) über. Die Laake gehört heute zum Gut Borlinghausen, Haferhausen ist Besitz des Freiherrn v. Oer zu Egelborg bei Legden (1816 vom Grafen von Bocholtz gekauft, seit 1912 Besitz des Freiherrn von Vittinghoven, gen. von Schell, jetzt durch Heirat an den Freiherrn von Oer), und Bülheim gehört einem Gutsbesitzer namens Petri.
Willebadessen, seit 1318 ein Landstädchen, war noch um 1800 ein "elendig armes Bauerndorf" von nicht einmal 1000 Einwohnern.

